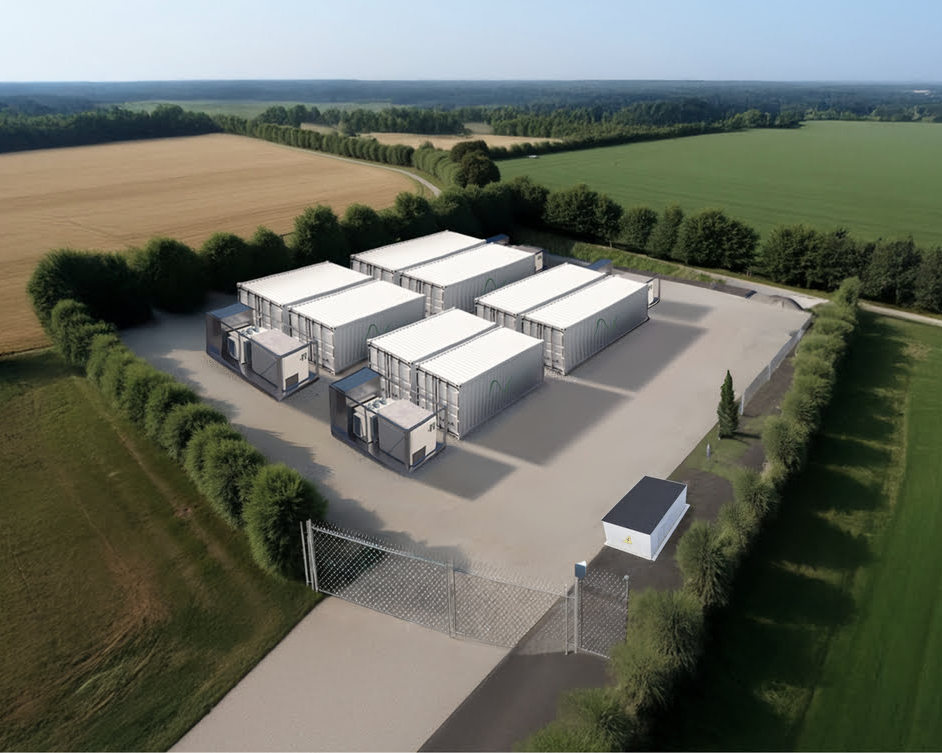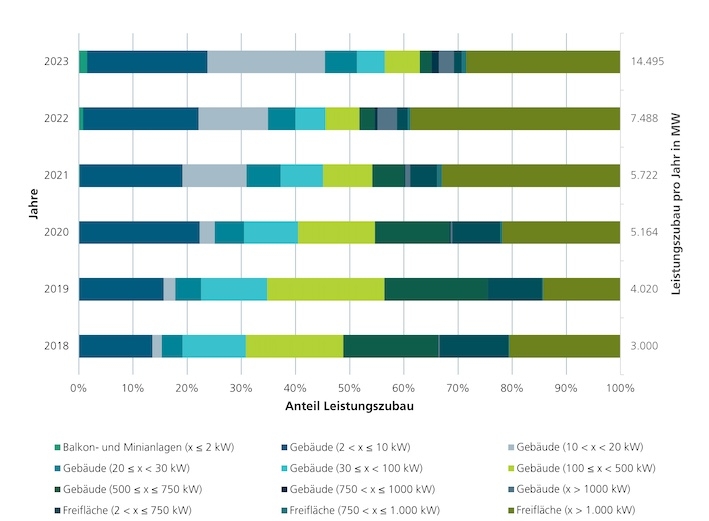Batteriespeicher als Schlüssel zur Netzstabilität
26.08.2025Großspeicher sind das Rückgrat eines flexiblen, zuverlässigen und erneuerbaren Energiesystems. Auf der ees Europe 2025 wurde deutlich: Die europaweite Nachfrage nach leistungsstarken Speichern steigt exponentiell, die Zahl der Netzanschlussanfragen erreicht Rekordhöhen und der Markt beginnt, sich rasant zu professionalisieren. Mit der wachsenden Volatilität an den Strommärkten und einem regulatorischen Umfeld im Wandel eröffnen sich für Speicherprojekte enorme wirtschaftliche Chancen.
Chancen beim Ausbau von Großspeichern
Der wachsende Anteil erneuerbarer Energien am europäischen Strommix liegt bei über 60 %, wie auch bei der Nettostromerzeugung im 1. Halbjahr 2025 zu sehen ist. Das stellt das Energiesystem vor zunehmenden Herausforderungen bei der Systemintegration. Als direkte Auswirkung auf diese Entwicklung nimmt die Zahl an Null- und Negativ-Stunden im Stromgroßhandel stetig zu, wie in Deutschland, Irland und Spanien. In diesen Ländern zeigt sich der Mangel an flexiblen Ressourcen zur Ausbalancierung von Angebot und Nachfrage, was den dringenden Bedarf an Großspeichern verdeutlicht. Großspeicher gelten als zentrale Flexibilitätsressource und puffern Überangebote, stabilisieren Netze und schaffen wirtschaftliche Wertschöpfung in zunehmend volatilen Märkten.
 Großspeicher auf der ees Europe 2025.
Großspeicher auf der ees Europe 2025.
Bild: Solar Promotion
Laut Anna Darmani, Analyst Energy Storage EMEA bei Wood Mackenzie, soll die installierte Batteriespeicherkapazität von 34 GW im Jahr 2024 in den nächsten zehn Jahren deutlich anwachsen. Dabei holen große Speicherprojekte auf – angetrieben durch neue Vermarktungsmodelle, die Großprojekte bankfähig machen. Darmani sprach sogar von einer neuen Phase, in die Batteriespeicher in Europa eintreten: „Die Diversifikation der Einnahmequellen wird immer wichtiger auf dem Markt. Damit sind neue Vertragsmodelle gemeint, wie Tolling-Verträge und hybride PPAs, die europaweit entstehen. Sie sind entscheidend, um großskalige Batteriespeicher in Europa attraktiv für Investitionen zu machen und Merchant Risk zu verringern“, erläuterte sie. Hybride PPAs sind Stromabnahmeverträge, die typischerweise Solaranlagen mit Batteriespeichern kombinieren. Diese erlauben es, Strom auch bei negativen Preisen oder Redispatch-Einsätzen gezielt zwischenzuspeichern und später zu höheren Marktpreisen zu verkaufen. Die tab hat in den letzten Monat auch über solche Projekte berichtet, zuletzt über ein Großspeicherprojekt im Landkreis Augsburg.
Balance zwischen Marktchancen und stabilen Einnahmen
Eine zentrale Frage für den weiteren Hochlauf von Großspeichern lautet: Wie lassen sich stabile Einnahmeströme mit den Chancen und Risiken des freien Strommarkts kombinieren, um Investitionen zu ermöglichen und Kapital effizient zu mobilisieren? Genau hier setzt das Konzept an, BESS-Kapital durch eine intelligente Mischung aus Sicherheit und Renditechancen freizusetzen.
Batterien profitieren von volatilen Energiemärkten – dort entfalten sie ihr volles Potenzial. Doch genau diese Volatilität schreckt Infrastrukturinvestoren und Kreditgeber ab, die auf planbare, vertraglich gesicherte Einnahmen setzen. Die Herausforderung: Die Marktstruktur bietet bislang nur wenige bankfähige Offtake-Modelle, insbesondere für Anlagen unter 20 MW, die kaum Zugang zu langfristigen Abnehmerverträgen erhalten. Hinzu kommt die Komplexität der Vermarktung im freien Markt, die spezialisiertes Know-how und ausgefeilte Optimierung erfordert – ein Investitionsrisiko, das viele Kapitalgeber scheuen.
Mikko Preuss, Vice President Strategy und Commercial bei Terralayr Germany, erläuterte auf der ees Europe Conference, wie sein Unternehmen diese Herausforderung adressiert. Mit einer zweiseitigen Flexibilitätsplattform verbindet Terralayr BESS-Anlagen über einheitliche Rahmenverträge mit unterschiedlichen Abnehmern – darunter Energieversorger, unabhängige Stromproduzenten (IPPs) und Industrieunternehmen. Dieses Modell ermöglicht es, stabile Einnahmen durch vertragliche Komponenten mit marktbasierter Wertschöpfung zu kombinieren – und damit Kapital für neue Großspeicherprojekte zu erschließen und Investitionen bankfähiger zu machen.
Netzdienlich oder netzbelastend? Eine deutsche Perspektive
Trotz zunehmender Investitionsbereitschaft und politischer Signale bleibt die Integration von Großspeichern in das deutsche Energiesystem ein Balanceakt zwischen technischer Notwendigkeit und regulatorischer Realität. Während der Bedarf an Flexibilität im Stromsystem rasant wächst, entstehen durch lokal restriktive Netzvorgaben neue Zielkonflikte – besonders dort, wo der Ausbau erneuerbarer Energien bereits weit fortgeschritten ist.
Gerade in Deutschland zeigt sich dieses Spannungsfeld besonders deutlich: Große Batteriespeichersysteme entwickeln sich zunehmend von Nischenanwendungen zu netzrelevanter Infrastruktur. Politische Maßnahmen wie §118 EnWG, das neu errichtete Speicher ab 2008 bis maximal 2030 vom Netznutzungsentgelt befreit, haben zahlreiche Projekte wirtschaftlich tragfähig gemacht. Gleichzeitig aber bremsen wachsende systemische Vorbehalte den Ausbau: In PV-starken Regionen wie Bayern führen restriktive Netzanschlussauflagen dazu, dass Speicher zu bestimmten Zeiten nicht geladen oder entladen werden dürfen – was die Einnahmen um bis zu 30 % verringert. Obwohl solche Vorgaben dem Netzschutz dienen sollen, drohen sie die Skalierung dringend benötigter Flexibilitätsoptionen massiv zu behindern.
Benedikt Deuchert, Head of Business Development und Regulatory Affairs bei Kyon Energy, betonte auf der ees Europe Conference: „Um sicherzustellen, dass Batteriespeicher das Netz stützen und nicht belasten, sind intelligentere Integrationsrahmen erforderlich. Entwickler und Regulierer müssen sich von starren Vorgaben lösen und hin zu dynamischen, bedarfsorientierten Steuerungen übergehen, ermöglicht durch Echtzeit-Redispatch-Signale und vergütete Flexibilitätsdienste. Flexible Netzanschlussvereinbarungen (FCA) müssen ihrem Namen gerecht werden: Sie sollten netzdienlichen Betrieb ermöglichen, nicht behindern. Und dauerhafte Netzentgeltbefreiungen sollten netzstützendes Verhalten belohnen.“