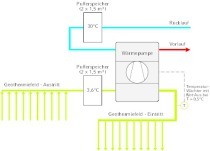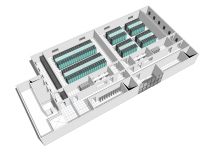Notstrom-Dieselmotoranlagen in Rechenzentren
Die Höhe des Schornsteins ist entscheidendBei der Planung von Rechenzentren mit Diesel-Notstromanlagen darf die erforderliche Schornsteinhöhe nicht unterschätzt werden. Auch wenn die Anlagen nicht immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftig sind, greifen dennoch verbindliche Vorgaben. Insbesondere § 19 der 44. BImSchV (Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) sowie die TA Luft regeln Mindestanforderungen zur Ableitung von Abgasen – ein Detail mit weitreichenden Folgen, das frühzeitig beachtet werden muss.
Notstromaggregate auf Dieselbasis gelten in der Rechenzentrumsplanung als essenziell. Bei einem Netzausfall übernehmen sie unmittelbar die Stromversorgung der sensiblen IT-Infrastruktur. Damit diese Aggregate ihre Funktion erfüllen können, müssen die entstehenden Abgase sicher abgeführt werden. Dabei stellt die Schornsteinhöhe nicht nur ein bauliches Detail dar, sondern eine juristische Verpflichtung. Auch Anlagen, die keine Genehmigung nach dem BImSchG benötigen, müssen nach § 22 BImSchG schädliche Umwelteinwirkungen vermeiden. Die Betreiberpflichten ergeben sich insbesondere aus der 44. BImSchV.
Konkret fordert § 19 der Verordnung, dass ab einer Feuerungswärmeleistung (FWL) von einem Megawatt eine Berechnung der erforderlichen Schornsteinhöhe vorzunehmen ist. Besonders relevant ist das für Rechenzentren mit mehreren Dieselgeneratoren: Hier wird die Gesamtleistung aggregiert betrachtet. Eine zu niedrig gewählte Schornsteinhöhe kann sich im Nachhinein als teures Versäumnis erweisen, etwa wenn eine Erweiterung geplant wird und statische oder räumliche Restriktionen einer Nachbesserung entgegenstehen. Je früher die Anforderungen in die Planungen einbezogen werden, desto eher lassen sich kostenintensive Nachbesserungen vermeiden.
Normative Grundlagen und Berechnungsverfahren
Für Anlagen mit einer FWL von einem bis zehn Megawatt gelten Mindestmaße: mindestens 10 m Schornsteinhöhe sowie 3 m Überragung des Firstes auf dem Dach. Liegt die FWL darüber oder ist die Anlage genehmigungspflichtig, greifen die Vorgaben der TA Luft. Hierbei wird zwischen zwei Höhen unterschieden: einer gebäudebezogenen (nach VDI 3781 Blatt 4) und einer emissionsbezogenen Höhe, berechnet etwa mit dem Programm BESTAL. Letztere muss bei Bedarf um Bebauung und Bewuchs korrigiert werden. Ausschlaggebend ist jeweils der höhere Wert.
Die Berechnungen erfolgen auf Grundlage einer Kombination aus technischen Parametern wie Abgasvolumenstrom, Temperatur, Emissionskonzentration sowie standortspezifischen Gegebenheiten. Die Berücksichtigung von benachbarten Gebäuden, Geländestrukturen und klimatischen Bedingungen ist dabei ebenfalls äußerst wichtig, um realistische Ausbreitungsbedingungen für die Abgase zu erfassen.
Immissionsprognose und Betriebszeiten
Wird durch die Anlagen eine bestimmte Schadstoffmenge – der sogenannte Bagatellmassenstrom – überschritten, ist zusätzlich eine Immissionsprognose erforderlich. Ziel ist es, den maximal zulässigen Betrieb im Notstromfall festzulegen, ohne die geltenden Grenzwerte zu verletzen. Die Berechnung erfolgt modellhaft für einen fiktiven Ganzjahresbetrieb, wobei so lange skaliert wird, bis Grenzwerte oder Irrelevanzschwellen eingehalten werden.
Ein weiterer Aspekt betrifft den Eintrag von Stickstoff- und Säureverbindungen in FFH-Gebiete oder Biotope. Auch hier muss in der Regel eine Unterschreitung der Irrelevanzschwelle nachgewiesen werden. In Hessen etwa bietet der Leitfaden des Regierungspräsidiums Darmstadt eine standardisierte Herangehensweise zur Bestimmung von Schornsteinhöhen und zulässigen Betriebszeiten, was insbesondere für Sachverständige und Genehmigungsbehörden Planungssicherheit schafft.
Gestaltungsspielräume nutzen
Nicht selten führen die Schornsteinhöhenberechnungen zu Höhen von 50 bis 100 m. Das steht oftmals in keinem sinnvollen Verhältnis zur tatsächlichen Nutzung – etwa für monatliche Testläufe von je einer Stunde. Eine Immissionsprognose kann in solchen Fällen nachweisen, dass auch mit niedrigerer Höhe alle Anforderungen eingehalten werden.
Zusätzliche Möglichkeiten ergeben sich durch technische und bauliche Optimierungen: So kann eine Gruppierung der Schornsteine die Abströmung verbessern. Eine Isolierung reduziert Temperaturverluste der Abgase, was deren Aufstieg erleichtert. Emissionen lassen sich zudem durch SCR-Anlagen oder Oxidationskatalysatoren mindern. Auch der Einsatz moderner, emissionsarmer Motorentechnologie spielt zunehmend eine Rolle und sollte frühzeitig in die Planung integriert werden.
Zukünftige Verschärfungen im Blick behalten
Mit der Novelle der TA Luft von Ende 2021 wurden die Anforderungen an neue Anlagen verschärft. Bestandsschutz besteht nur für unveränderte Altanlagen. Bei Erweiterung oder Umbau gilt das aktuelle Recht, was regelmäßig eine Erhöhung der Schornsteine zur Folge hat. Darüber hinaus bringt die neue EU-Luftqualitätsrichtlinie vom 14.10.2024 weitere Immissionsgrenzwerte ab 2030 mit sich. Betreiber werden daher vermehrt auf Abgasreinigung setzen müssen oder mit kürzeren maximalen Betriebszeiten im Notfall rechnen. Die geplanten Verschärfungen machen deutlich, dass sich zukunftssichere Planung nicht mehr allein auf bestehende nationale Vorschriften stützen darf, sondern den europäischen Rahmen konsequent mitdenken muss.
Gutachterliche Unterstützung von Beginn an
Um Planungsfehler zu vermeiden, ist die frühzeitige Einbindung eines externen Gutachters ratsam. Derartige Berechnungen werden unter anderem von TÜV Hessen durchgeführt. Neben der Bestimmung der Schornsteinhöhe kann mit gutachterlicher Unterstützung bereits vor dem Grundstückskauf durch eine Immissionsprognose geprüft werden, ob mit der geplanten Anlage die geltenden Grenzwerte eingehalten werden können. Auch während des Betriebs bleibt TÜV Hessen Ansprechpartner, etwa für Lärmmessungen, Gebäudetechnikprüfungen oder Zertifizierungen nach DIN EN ISO/IEC 27001. Die Erfahrung zeigt: Betreiber, die frühzeitig auf fachliche Expertise setzen, profitieren langfristig von größerer Rechtssicherheit, niedrigeren Betriebskosten und nachhaltiger Standortentwicklung.
Fazit
Die gesetzlich geforderte Schornsteinhöhe für Notstromdieselanlagen ist kein Randthema, sondern zentral für Genehmigungssicherheit und Umweltschutz. Eine korrekte Berechnung auf Basis der TA Luft und der 44. BImSchV ist unverzichtbar – ebenso wie eine vorausschauende Planung unter Berücksichtigung künftiger Verschärfungen. Externe Fachgutachter wie TÜV Hessen können Betreiber frühzeitig unterstützen, um kostenintensive Planungsfehler zu vermeiden und regulatorischen Anforderungen langfristig gerecht zu werden.