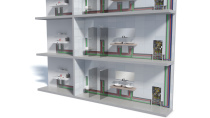Wissenstransfer im Planungsbüro
KTO engineering: Fachsymposien zu Wasserstoff, Gebäudeautomation und TrinkwasserhygieneDie KTO engineering GmbH & Co. KG, ein im bayerischen Bad Grönenbach ansässiges Ingenieurbüro für TGA, plant seit mehr als 20 Jahren nachhaltige Projekte und begleitet deren Umsetzung auf der Baustelle. Essenziell für jedes Unternehmen ist das Fachwissen seiner Beschäftigten, aber auch deren Erfahrung. Aus diesem Grund entschlosss sich das Allgäuer Planungsbüro Mitte 2023 eine firmeninterne Weiterbildungsakademie ins Leben zu rufen. Zum 20-jährigen Jubiläum hatte das Unternehmen drei Referenten zu aktuellen Themenschulungen eingeladen.
Der Slogan der KTO engineering Akademie lautet: „… die aus Erfahrung Wissen schafft.“ Dazu erklärt Manfred Mair, Leiter der Akademie: „In unserer firmeninternen Weiterbildungsakademie geht es vor allem darum, das Wissen und die gesammelten Erfahrungen der langjährigen Beschäftigten zusammenzuführen und dieses gepaart mit aktuellen Gesetzen, Verordnungen, Normen und Regelwerken an die jungen Kolleginnen und Kollegen weiterzugeben.“ Im Ergebnis würde dies die Mitarbeitermotivation fördern und die Position des Unternehmens als verlässlicher Partner für die Kunden stärken.
Anlässlich des...
Der Slogan der KTO engineering Akademie lautet: „… die aus Erfahrung Wissen schafft.“ Dazu erklärt Manfred Mair, Leiter der Akademie: „In unserer firmeninternen Weiterbildungsakademie geht es vor allem darum, das Wissen und die gesammelten Erfahrungen der langjährigen Beschäftigten zusammenzuführen und dieses gepaart mit aktuellen Gesetzen, Verordnungen, Normen und Regelwerken an die jungen Kolleginnen und Kollegen weiterzugeben.“ Im Ergebnis würde dies die Mitarbeitermotivation fördern und die Position des Unternehmens als verlässlicher Partner für die Kunden stärken.
Anlässlich des 20-jährigen Firmenjubiläums veranstaltete die KTO engineering Akademie Ende 2024 eine Fachsymposien-Reihe mit drei ausgewählten Referenten zu den Themen „Wasserstoff – Aktueller Stand und Praxisbeispiel“, „Gebäudeautomation – Quo vadis?“ und „Erkenntnisse in der Trinkwasserhygiene“. Nachfolgend dazu eine Zusammenfassung.
Wasserstoff – Aktueller Stand und Praxisbeispiel
Dipl.-Ing. Jörg Schütz, seit 1997 Mitglied im DVGW-Ausschuss G 600, gab einen Überblick über den Einsatz von Wasserstoff als Energieträger. Grundlage ist die nationale Wasserstoffstrategie (NWS), die von der Politik erstmals im Jahr 2020 verabschiedet und veröffentlicht wurde. Die wesentlichen Handlungsfelder der NWS sind die Erzeugung, Verteilung und die vielfältige Anwendung von Wasserstoff in Kraftwerken, Industrie und Gewerbe sowie bei Mobilität und Gebäuden. „In allen Handlungsfeldern wird schon seit Jahren mit Hochdruck geforscht und an der Fertigstellung von Regelwerken gearbeitet“, erklärte Jörg Schütz. Für den Bereich der TGA seien schon zahlreiche erfolgreiche Forschungsprojekte mit verschiedenen Wasserstoffanteilen (20 bis 100 %) im Gemisch mit Erdgas durchgeführt worden, z. B. über die Beeinflussung von Bauteilen der Gasinstallation oder den Nachweis der Funktion von Gasgeräten. Obenan stehen dabei immer die sicherheitstechnischen Aspekte. Dazu Schütz: „Durch erste regionale Forschungsvorhaben, z. B. in einem Ortsteil mit 350 Gasgeräten, konnte die Praxistauglichkeit von Erdgas-Wasserstoff-Gemischen mit einem 20-prozentigen Anteil H2 nachgewiesen werden. Auch kleinere Netze mit 100 % reinem Wasserstoff werden bereits untersucht. Man ist in kurzer Zeit bereits auf einem guten Weg.“
Gebäudeautomation – Quo vadis?
Prof. Dr.-Ing. Martin Becker, Inhaber des Ingenieurbüros Prof. Dr. Becker und Prof. im Fachgebiet MSR-Technik, Gebäudeautomation und Energiemanagement an der Hochschule Biberach, zeigte in seinem Vortrag auf, dass Planer vor enormen Herausforderungen stehen, um den Bestand und Neubau von Gebäuden nachhaltig zu planen, auszuführen und zu betreiben. Im Kontext der großen Transformationsprozesse Energiewende, Klimaschutz und Digitalisierung wachsen Gebäude- und Energietechnik immer mehr zu einer Gebäudeenergietechnik zusammen, wobei hierfür zunehmend digitalisierte Entwurfs-Methoden und Planungs-Werkzeuge eingesetzt werden. Hierbei geht es nicht nur um eine möglichst ganzheitliche und gewerkübergreifende Betrachtung des Gebäudes selbst (Gebäude als System), sondern auch ergänzend um die passende Einbindung von Gebäuden in eine Quartiersumgebung (Gebäude im System). Dies erfordert u. a. auch ein ganzheitliches und bereits in frühen Planungsprozessen konzipiertes, übergeordnetes Gebäudeautomationsmanagement. Das umfasst z. B. auch die Art und den Umfang eines technischen Monitorings für ein durchgehendes Qualitätsmanagement und die kontinuierliche Qualitätssicherung für einen energie- und ressourcenschonenden Gebäudebetrieb. Das „Technische Monitoring“ (TMon) kann – wenn es frühzeitig im Planungsprozess bereits passend mitberücksichtigt wird – auch als Mehrwert für einen daten- und automationsgestützten Inbetriebnahme- und Einregulierungsprozess mit genutzt werden. Zusammengefasst betrifft dies u. a. folgende Bereiche:
Frühzeitige Festlegung der wesentlichen Anforderungen an ein GA-System und das TMon bereits in der Bedarfsplanung,
Gesamtheitliche Planung der GA als eigenständiges Gewerk nach Kostengruppe 480 und gemäß Richtlinie VDI 3814 bestehend aus Anlagenautomation, Raumautomation und GA-Management,
Berücksichtigung des TMon als wichtiger Teil eines zeitgemäßen GA-Managements bzw. GA-Systems,
Definition und konsequente Verwendung eines eindeutigen Kennzeichnungssystems (KS),
Frühzeitige Konzeption und konsequente Umsetzung eines Informationsmanagements (analog zum Energiemanagement),
Zunehmender Einsatz von durchgehenden, aufeinander abgestimmten Engineering-Werkzeugen inklusive Kopplung zu BIM-Tools.
Erkenntnisse in der Trinkwasserhygiene
Unter dieser Überschrift zeigte Dr. Peter Arens, promovierter Mikrobiologe und ö. b. u. v. Sachverständiger für das Teilgebiet Trinkwasserhygiene im Installateur- und Heizungsbauer-Handwerk der Handwerkskammer Südwestfalen, Installationsarten und deren möglichen Auswirkungen für die Trinkwasserhygiene auf. Im Fokus einer hygienischen Trinkwasserversorgung empfiehlt der Experte, je nach Gebäude- und Nutzungsanforderungen, i. d. R. die T-Stück-Installation, wobei zirkulierendes Warmwasser immer von oben an die Armaturen herangeführt werden muss – mit mindestens 150 mm Abkühlstrecke. Dazu betonte Dr. Arens: „Wichtig ist, dass der Wasserwechsel nicht nur im Rohrdurchfluss, sondern über den Auslauf an allen Entnahmestellen stattfinden muss – und dies ist seit mehr als 11 Jahren eine Forderung im Regelwerk.“ Zudem sei zu beachten, dass keine Erwärmung des kalten Trinkwassers durch den möglichen Wärmeübertrag von warmführenden Trinkwasserleitungen entsteht, wie dies z. B. von einem Ringleitungssystemen in einer Vorwandinstallation der Fall sein kann.
Mit Hinweis auf eine Studie der FH Münster von Prof. Dr. Ing. Franz-Peter Schmickler und M. Eng. Stefan Cloppenburg zeigte Dr. Arens weitere Vorteile für die altbewährte Installationsart auf: Bei einem Schulneubau (Gymnasium mit Sporthalle) wurde die Trinkwasserinstallation einmal als T-Stück-Installation dimensioniert und einmal als Ring-in-Ring-Installation mit Venturidüsen. Die T-Stück-Installation war um 21 % kostengünstiger (= 53.000 €) und wies 25 % weniger Wasserinhalt auf. „Durch diesen geringeren Wasserinhalt werden schon während der normalen Nutzung die Wasserwechsel deutlich erhöht und damit die Trinkwasserhygiene sichergestellt. Und in den Schulferien wird zukünftig auch nur dieses deutlich verringerte Wasservolumen auszutauschen sein, wodurch die natürlichen Ressourcen des Trinkwassers geschont werden“, so Dr. Arens. Des Weiteren wies die T-Stück-Installation in dem Beispiel eine um 29 % geringere Oberflächen auf. „Innere Oberflächen sind Siedlungsraum für Bakterien, während äußere Oberflächen Wärme abgeben (Warmwasser = vermeidbare Energieverluste) bzw. Wärme aufnehmen (Kaltwasser = erhöhte hygienische Risiken). Dabei ist insbesondere diese vermeidbar überhöhte Wärmeaufnahme im Hinblick auf eine übermäßige Vermehrung von Legionellen im erwärmten Kaltwasser ein Problem, da die Wärme in einem um 25% erhöhten Wasservolumen gespeichert wird“, erklärte Arens.
Das Abschlussplädoyer des Referenten war für die Zuhörer somit nachvollziehbar, dass die Branche seit ca. 3 Jahren wieder verstärkt auf T-Stück-Installationen setze. Denn diese Installationsform senke unmittelbar die Installationskosten und den ökologischen Fußabdruck der Trinkwasserinstallation. Vor allem aber senke sie über die gesamte Lebensdauer der Installation auch die Betriebskosten beim Trinkwasser, Abwasser und der Energie (Warmwasser). Dr. Arens abschließend: „Diese Effekte können nochmals gesteigert werden, wenn die Dimensionierung der Trinkwasserinstallation unter Berücksichtigung verringerter Berechnungsdurchflüsse erfolgt, z. B. Waschtischarmaturen mit 0,03 l/s statt 0,07 l/s.
Fazit
Wissenstransfer und Weiterbildung sind für alle am Bau Beteiligten elementar. KTO engineering hat aus dieser Weisheit eine Tugend gemacht und schult die Beschäftigten inhouse weiter. Dazu werden auch externe Referenten zu aktuellen Themen eingeladen. Darüber hinaus sind zu diesen Maßnahmen ggf. auch Auftraggeber eingeladen, sodass sich Projekte leichter entwickeln lassen.