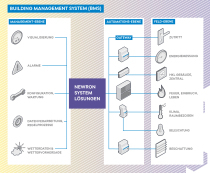Gebäudeautomation mittels KNX
KNX-Technologie für Neubau und Sanierung, für große und kleine GebäudeVor knapp 30 Jahren als offener und herstellerunabhängiger Übertragungsstandard in der Gebäudeautomation konzipiert, verbucht KNX heute eine breite Akzeptanz bei Planern und Auftraggebern. Doch nicht nur im Neubausektor spielt das System seine Stärken aus: Gerade bei der energetischen Gebäudesanierung bietet es für eine ganzheitliche Gebäudeautomation viele Vorteile, wie das Beispiel der Sanierung eines komfortablen EFH in Fulda zeigt. Sämtliche TGA-Anlagen bis zur Einzelraumregelung werden dort per KNX-System geregelt.
Der Schwerpunkt bei der „Smartifizierung“ des aus den frühen 1980er Jahren stammenden Anwesens lag auf dem intelligenten Zusammenspiel der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Ausgestattet mit zwei Wärmepumpen, einer Gasbrennwertherme und je einem Pufferspeicher für Wärme und Kälte, bestand die Herausforderung darin, einen bedarfsgerechten Regelkreislauf dieser Anlagen mit den auf Raumebene verbauten HLK-Komponenten zu integrieren. Diese bestehen aus mehreren im Unter- und Obergeschoß verbauten Klimageräten, teilweise ergänzt durch eine Fußbodenheizung. Als Besonderheiten kommen zu diesem...
Der Schwerpunkt bei der „Smartifizierung“ des aus den frühen 1980er Jahren stammenden Anwesens lag auf dem intelligenten Zusammenspiel der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Ausgestattet mit zwei Wärmepumpen, einer Gasbrennwertherme und je einem Pufferspeicher für Wärme und Kälte, bestand die Herausforderung darin, einen bedarfsgerechten Regelkreislauf dieser Anlagen mit den auf Raumebene verbauten HLK-Komponenten zu integrieren. Diese bestehen aus mehreren im Unter- und Obergeschoß verbauten Klimageräten, teilweise ergänzt durch eine Fußbodenheizung. Als Besonderheiten kommen zu diesem Setup noch eine Heizung für das Schwimmbad sowie eine über dem Wohn- und Essbereich installierte Kühldecke.
Ein Automatisierungscontroller als Herzstück
Die Orchestrierung dieser Komponenten zu einer effizienten Klimaregelung übernimmt die auf dem von ABB i-bus KNX-System basierende Automatisierungslösung „ClimaEco“ mit dem Automatisierungscontroller „AC/S1.2.1“. Schwellenwerte, die permanent mit den Daten einer ABB-Wetterzentrale vom Typ „WZ/S“ und weiterer Temperaturfühler abgeglichen werden, bilden die Grundlage für den bivalenten Betrieb der beiden Luft/Wasser-Wärmepumpen (jeweils 10 kW) und der Gastherme (38 kW). Sobald die Speichertemperatur unter den voreingestellten Wert von 46 °C sinkt und die Leistung der Wärmepumpen in Spitzenlastzeiten nicht ausreicht, gleicht die Gastherme den fehlenden Wärmebedarf aus. Analog hierzu sind auch für die Außentemperatur bestimmte Datenpunkte und Aktionen hinterlegt. Werden beispielsweise 15 °C Außentemperatur überschritten, setzt automatisch der Kühlbetrieb ein, wobei eine Wärmepumpe zunächst für die Kühlung, die andere für die Wärmerzeugung zuständig ist. Ein Betriebsartenwechsel alle 24 Stunden sorgt für eine gleichmäßige Inanspruchnahme der Technik. Unter 5 °C Außentemperatur übernimmt ausschließlich die Gastherme den Heizbetrieb.
Warum der Zugriff auf bestimmte Messwerte eine smarte Idee ist, lässt sich gut am Beispiel der Kühldecke demonstrieren. Das Busch-„Tenton“-Raumbediengerät erfasst die Werte der relativen Luftfeuchtigkeit und der Raumtemperatur und berechnet daraus die Taupunkttemperatur. So wird sichergestellt, dass die maximale Menge Wasser, das die Raumluft aufnehmen kann, nicht überschritten wird. Um zu verhindern, dass sich bei besonders hoher Außentemperatur durch das Temperaturgefälle Kondenswasser an der Kühldecke bildet, gleicht das System die Ist-Temperatur mit in Abhängigkeit zur Außentemperatur gespeicherten Sollwerten für die Vorlauftemperatur ab, bei 1 K Toleranz. „Klassische Anlagen schalten in solchen Fällen die Kühldecke einfach ab. Bis zur Wiederinbetriebnahme vergehen so oft Stunden, in denen keine Kühlung erfolgt“, erklärt Dipl.-Ing. Ralph Christoph, Kundenbetreuer bei ABB, und weiter, „durch die KNX-basierte Taupunktberechnung kann die Anlage hingegen mit weniger Energie trotzdem weiterbetrieben werden. Die Berechnungen hierfür werden durch den Automatisierungscontroller ausgeführt.“
Technologieoffenheit bringt Planungssicherheit
Was die KNX-Technologie dem Experten zufolge gegenüber proprietären Lösungen so attraktiv macht, ist die Kompatibilität aller Produkte, die nach diesem Standard zertifiziert sind: „Geschlossene Systeme zwingen Bauherren, diejenigen Lösungen zu nutzen, die ein Anbieter bereitstellt, was auch preislich keinerlei Flexibilität zulässt. Viele Bauherren fühlen sich heute über den Tisch gezogen, weil bei einigen Anbietern nach zehn oder zwölf Jahren der Produktzyklus endet und nur noch der Neukauf eines Systems bleibt“, so Christoph. Der KNX-Standard ermögliche hingegen eine große Auswahl an Herstellern, die gewerkeübergreifende Funktionsweise und eine individuelle Skalierbarkeit. „Bauherren, Wohn- und Hauseigentümern sind dadurch bei der Ausgestaltung ihres Systems nahezu keine Grenzen gesetzt. Einen zusätzlichen Mehrwert bietet die Möglichkeit, per Web-Benutzeroberfläche des Automatisierungscontrollers von der Ferne aus auf das System zugreifen zu können“, so Christoph weiter. Auch hier sind Kunde und Systemintegrator nicht an eine bestimmte Lösung gebunden, sondern können die für sie passende Lösung wählen. Als Fernzugriffslösung kommt ein VPN-Baustein eines anderen Herstellers zum Einsatz. Wichtige Systemmeldungen werden direkt ans Smartphone übermittelt, was kurze Reaktionszeiten ermöglicht.
Unterschiedliche Smart-Home-Komponenten integriert
Über die beschriebenen „ClimaEco“-Lösungen hinaus wurden dabei noch viele weitere Smart-Home-Komponenten integriert. So werden beispielsweise auch die Pool-Beleuchtung und -abdeckung über KNX kontrolliert, ebenso wie die Logiksteuerungen für Rolladen-Aktoren und Garagentore. Im Untergeschoß dienen „ABB DALI Gateways“ als Schnittstellen, um das digitale Lichtsteuersystem in die Gebäudeautomation einzubinden. Für die direkte Interaktion mit der Technik wurde auf die breite Palette der von Busch-Jaeger angebotenen Schalterlösungen zurückgegriffen, einschließlich zweier Touchdisplays und einer Busch-Sprechanlage. Busch-Rauchwarnmelder schützen die Bewohner und warnen die Bewohner bei Rauchentwicklung. Aufgrund der ausgeprägten Technikaffinität des Bauherrn werden sich vermutlich bald weitere Komponenten hinzugesellen.
Neben der Leistungsfähigkeit der Technologie selbst, waren es insbesondere die Aufgeschlossenheit und Begeisterung sämtlicher Beteiligter, die ganz wesentlich zum Erfolg von Projekten wie diesem beitragen. Dazu gehörte, dass sämtliche Dienstleister mitzogen und entsprechend kompetent agierten. „Um die Scheu vor der vermeintlich zu komplizierten Technik zu überwinden und das lohnende Geschäftsfeld für sich zu erschließen, empfehlen wir Architekten, Planern und HLK-Anbietern zu selbstbewusstem Pragmatismus. Denn setzt man sich eingehender mit der Thematik auseinander, merkt man schnell, dass die Anforderungen nicht so komplex sind, wie viele denken. Unterstützung bieten hierzu auch unsere ‚ClimaEco‘-Schulungen, die ein breites Fachwissen vermitteln und viele praktische Tipps zur Umsetzung geben“, so Christoph abschließend.